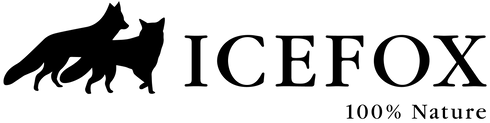Schwarzwild: Eichen und Buchen sollst Du suchen!
Tragen Stiel- oder Traubeneiche sowie Buchen ordentlich Mast, ist der Tisch fürs Schwarzwild reich gedeckt. Nun gilt es die Jagdstrategie zu ändern, da die Kirrungen verwaist bleiben.
Wieder einmal war im März eine Nachtschicht angesagt. Denn die Stieleichen im Revier trugen eine ordentliche Mast, und so drängten die Sauen auch immer wieder raus auf die Wiesen, um nach tierischem Eiweiß zu brechen. Ich hatte „Akki’s Sitz“ kurz nach halb acht bezogen und staunte nicht schlecht, als ich nur 40 Minuten später auf rund 250 Meter eine Rotte auf einer Weide unter einer Solitär-Eiche ausmachen konnte.
Der Wind passte, zudem raubte der Schneeregen Jäger und Gejagten etwas Sicht und vor allem Gehör. Mit der Foxterrierdame „Emma“ hinten im Rucksack pirschte ich die Sauen erst auf der dunklen Asphaltstraße und dann Schritt für Schritt über ein Feld an. Am Stacheldrahtzaun angekommen, waren es noch gut 50 Meter. Innehalten und über das 6x42 der BBF54 die Rotte sortieren.

Die Jagd im Feld ist die Pflicht, die Pirsch unter
den Mastbäumen die Kür.

Die Jagd im Feld ist die Pflicht, die Pirsch unter
den Mastbäumen die Kür.
Sie bestand aus einer Bache, drei oder vier Überläufern und ein paar Frischlingen. Die Schwarzkittel standen in einer Erdvertiefung, ähnlich einer Suhle, und brachen nach Eicheln und Getier, verschwammen aber mit dem braunen Untergrund. Fast eine halbe Stunde kauerte ich am Weidezaun, pirschte in niedriger Gangart noch zehn Meter weiter, da bot sich plötzlich eine Chance: Ein Frischling stand etwas abseits auf einem helleren Stückchen Wiese. Eingestochen, und „Rumms“ schickte ich das 10,5-g-Kegelspitz auf die kurze Reise. Im Knall war die Bühne leer. So ein Mist! Unterm Zaun durch stand ich fünf Minuten später aber dann doch vor einem 25-kg-Frischling. Er hatte im Schuss eine kurze Flucht gemacht und war im Bodenloch umgekippt und daher nicht zu sehen. Das war in diesem Revier, heute würde man es wohl „Green Office“ nennen, meine Abschiedssau, denn beruflich zog ich weiter …
Grundlegendes zu den schwarzen Rittern
Schwarzwild ist eine jagdlich äußerst faszinierende Wildart. Die aber auch ein enormes und nicht zu unterschätzendes Wildschadenspotential mit sich bringt. Da unsere Winter immer milder werden, die Frequenz der Mastjahre steigt und die Sauenbestände danach förmlich explodieren, werden abgeschlagene, auf Wanderschaft gehende Überläufer zunehmend auch neue Gebiete und Reviere erobern. Hier kann man nur jeden Jagdpächter eindringlich davor warnen, es den Sauen gemütlich zu machen. Anstatt Kirreimer, Körnermais und Buchenholzteer heißt das Gebot der ersten Stunde scharfes Jagen! Damit sich die „Steckdosen“ dort gar nicht erst heimisch fühlen.
Schwarzwild wittert und vernimmt sehr gut, äugt aber schlecht. Hat man also guten Wind und pirscht leise vorwärts, ist es oft erstaunlich, wie dicht man an eine Rotte, die meist selbst einen Heidenlärm im Gebräch veranstaltet, herankommt.

Im Winter erleichtert der weiße Leithund
zumindest das Abfährten im Revier.

Im Winter erleichtert der weiße Leithund
zumindest das Abfährten im Revier.
Niemand Geringeres als der legendäre Forstmeister Rudolf Frieß stand im Spessart in guten Mastjahren im dichten Altholz halbe Nächte lang sozusagen unter den dort brechenden Sauen; mitten im Grunzen, Murksen und lauten Geschrei, wenn sich Frischlinge anrempelten oder Keiler in der Rauschzeit nach Mast brachen. Dabei mieden sie laut Frieß in mondhellen Nächten das Feld wie der Teufel das Weihwasser, und selbst im Bestand verstanden sie es meisterhaft, mondbeschienene Flecken zu umgehen.
Beunruhigung wird durch Schnaufen und Blasen angezeigt. Der klassische Alarmlaut ist ein kurzes, käftig-abgehacktes „Wuff“, das die sofortige Flucht – meist der ganzen Rotte – auslöst.
Sauen gewähren oft eine zweite Chance
Eine Eigentümlichkeit beim Schwarzwild ist das ruckweise Verhoffen bei Beunruhigung oder Unsicherheit. Läuft man zufällig in den Kessel, verhoffen die Sauen in der Regel nach zehn, zwölf Fluchten. Ebenso, wenn man in eine Rotte reinpirscht und dabei „auffliegt“. Ich erinnere mich an einen 19. Dezember zurück: Ich hatte bei Schnee (der den Knall zusätzlich schluckt) auf 145 Schritt eine an einem Kaffhaufen brechende Rotte beschossen. Während das 33-kg-Frischlingskeilerchen im Knall auf der Seite lag, verhoffte die Rotte nach kurzer Flucht wieder. Die zweite Kugel blieb im Lauf, denn Arbeitskollege Matthias und mir reichte damals ein strammer Kujel.
Die Rauschzeit kann bei reichlich Fraß schon Ende Oktober beginnen, aber meist setzt sie erst im November ein. In besonders schlechten Jahren schiebt sie sich raus bis Dezember. Die Bachen frischen (die Faustzahl lautet 3-3-3 = drei Monate, drei Wochen, drei Tage) dann entsprechend von Ende Februar bis Mai. Von den zehn Zitzen führen nur acht Milch, weshalb die Zahl in der Regel auf acht Frischlinge begrenzt ist. Frischlings- und Überläuferbachen haben meist weniger Frischlinge. Durch besondere Fraßverhältnisse, Nachrausche (z.B. beim frühen Verlust der Frischlinge) und andere Faktoren kann es vorkommen, dass mehr als einmal im Jahr gefrischt wird.

Liegen Eicheln und Bucheckern auf dem Boden,
macht die Jagd an der Kirrung keinen Sinn mehr.

Liegen Eicheln und Bucheckern auf dem Boden,
macht die Jagd an der Kirrung keinen Sinn mehr.
Am feistesten werden die Sauen, wenn Eiche, Buche und – wo vorhanden – Kastanie gute Mast tragen. Von Oktober an ist das dann die Hauptnahrungskomponente, was auch durch Untersuchungen von Mageninhalten nachgewiesen wurde. Der angeborene Suchtrieb, das Brechen nach Unter- und Obermast, treibt sie an. Und so ziehen sie nachts von Masteiche zu Masteiche und von Buche zu Buche. Diese Nahrung reicht, je nach Intensität der Mast, bis weit ins Frühjahr hinein.
In Mastjahren ist alles anders
Es ist auch die Zeit, in der Pächter von Feldrevieren etwas aufatmen können, denn die Mast bindet die Sauen erstmal im Wald. Allerdings werden im Winter und Frühjahr gerne Wiesen aufgesucht, um dort nach Wurzeln von Kompositen (vor allem Bärenklau und Löwenzahn), aber darüber hinaus auch nach tierischem Eiweiß in Form von Mäusen, Erdraupen und Haarwürmern zu brechen. Dort gilt es, den jagdlichen Druck hochzuhalten, damit die Sauen im „sicheren“ Wald bleiben.
Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass man die Sauen in Ruhe lässt, weil sie ja vor allem im Wald beschäftigt sind. Allerdings ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Deutschland schon mehrfach nachgewiesen. Daher ist eine waidgerechte Bejagung – und ich sage ganz bewusst nicht Schädlingsbekämpfung – Jägerpflicht!
Sauen unter den Mastbäumen abzupassen, ist leichter gesagt als getan, vor allem bei noch vollem Blätterdach im Oktober. Jetzt sind die Blätter jedoch längst am Boden. Wer feste Saueneinstände in seinem Revier hat und schon vor dem Fruchtfall dort mehr oder weniger eine Wildruhezone einrichtet, kann später im Jahr sogar bei gutem Licht mit dem Anmarsch der Schwarzkittel rechnen.

Wildkameras geben in diesen schwierigen Zeiten Aufschluss
über Rottenbewegungen an Kirrungen, Suhlen und Mastbäumen.

Wildkameras geben in diesen schwierigen Zeiten Aufschluss
über Rottenbewegungen an Kirrungen, Suhlen und Mastbäumen.
Zunächst sind aber die Wechselgewohnheiten herauszufinden: Wann die Sauen zu den Wiesen, zu den Suhlen wechseln und wann sie unter den Mastbäumen auftauchen. Zum Abfährten und Bestätigen nutzt man idealerweise den frühen Vormittag. Dort, wo der meiste Betrieb (= Begängnis) auf den Hauptwechseln herrscht, gehören offene Kanzeln, Leitern oder einfache Erdsitze hin. Am besten mehrere, um stets unter gutem Wind lauern zu können. Die Sitzgelegenheiten dürfen aber nicht zu nah an den „Schwarzwild-Autobahnen“ stehen!
In der Ruhe liegt die Kraft
Schreckende Rehe sind nachts meist ein guter Indikator dafür, dass Sauen unterwegs sind, da sie den Weg des Schwarzwildes akustisch fast verfolgen. Auch Eulen kündigen manchmal marodierende Rotten an. Marschieren die an, sollte nicht gleich Dampf gemacht werden. Man lässt sie ruhig unter die Mastbäume ziehen. Erst dann beginnt die eigentliche Pirsch. Mit dem Schuss heißt es so lange zu warten, bis die Rotte fest im Gebräch steht und sich schön auseinanderzieht. Liegt ein abseits suchender Frischling oder Überläufer im Feuer, verhofft die Rotte oft nach kurzer erster Flucht. Unter Umständen genug Zeit, um ein zweites Stück sauber fassen und erlegen zu können.
Früher bestand die zusätzliche Herausforderung darin, im Bereich der Mastbäume durch gekonnten Holzeinschlag lichte Stellen zu schaffen, damit das Mondlicht dem Jäger unter die Arme greift. Heute kommt mit Wärmebildkamera und Vorsatz-Nachtsichtgerät schnell Licht ins Dunkle. Doch kein Licht ohne Schatten – wie sich die neuen Möglichkeiten der Nachtjagd auf das Verhalten der Schalenwildbestände auswirken wird, wird erst die Zukunft sicher zeigen!
Gern angenommene Alternativen
Morgens sind die natürlichen Kirrungen für die Sauen nur interessant, wenn eine in der Nähe befindliche Suhle lockt oder der Weg zum Einstand unmittelbar dort vorbeiführt. Dann statten die Schwarzkittel den Eichen und Buchen nochmal einen Kurzbesuch ab. Zumeist werden es Bachen mit Frischlingen oder gemischte Rotten sein, die man beim Anwechseln schon deutlich vernehmen kann.

Suhlen sind Wildmagnete nicht für Keiler,
sondern auch für gemischte Rotten.

Suhlen sind Wildmagnete nicht für Keiler,
sondern auch für gemischte Rotten.
Selbst wenn gut frequentierte Suhlen schon eine kleine Eisdecke haben, werden sie immer noch angenommen. Das Splittern des Eises hört man beim Ansitz oder Anstand gut im stillen Wald. An den Malbäumen betreiben alle Stücke ausgiebig ihre Körperpflege und hinterlassen Spuren. Etwa entsprechend ihrer Höhe, sodass man abschätzen kann, ob zur Rauschzeit ein Keiler bei der Rotte steht. Diese Stämme lassen sich durch Buchenholzteer und andere Substanzen zu unwiderstehlichen Magneten aufwerten.
Dass, wenn alles passt, am besten gleich mehrere Stücke zur Strecke kommen, ist bei den hohen Bestandszahlen und der zunehmenden Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest wichtig. Aber auch deshalb, weil die beschossene Rotte den Ort danach meist für längere Zeit meidet.

Hängt die wilde Sau im Kühlhaus, darf man sich bald
auf warme und kalte Köstlichkeiten freuen.
Dass, wenn alles passt, am besten gleich mehrere Stücke zur Strecke kommen, ist bei den hohen Bestandszahlen und der zunehmenden Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest wichtig. Aber auch deshalb, weil die beschossene Rotte den Ort danach meist für längere Zeit meidet.

Hängt die wilde Sau im Kühlhaus, darf man sich bald
auf warme und kalte Köstlichkeiten freuen.
Allerdings ziehen die attraktiven Waldfrüchte im Winter immer noch magisch an, selbst wenn die Mast nur gering ist oder man eher wenig Laubholz im Revier hat. Solange es nicht knüppelhart gefroren ist, wird dort auch im Schnee anhaltend und regelmäßig nach den abgeworfenen Eicheln und Bucheckern gebrochen. Im Zweifelsfall von einer neuen, unbeschossenen Rotte…

Text: F. und S. Numßen
Bilder: Patrick Pahlke - unsplash, Rolf Schmidbauer - unsplash, Nick Fewings - unsplash, Jonathan Kemper - unsplash, FN, SN