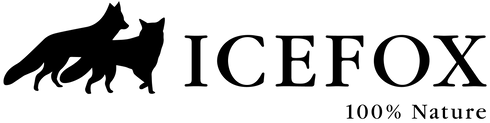Vom Raubtier zum Jäger
Aus Verfolgung der Tiere untereinander wurde durch den Einsatz von ersten primitiven Werkzeugen und später Waffen die von Menschen entwickelte Kultur der Jagd.
Räuber und Beute, das Spiel ist so alt wie die Natur selbst. Schon immer gab es Raubtiere, die ihren Beutetieren nachstellten – ob T-Rex und Hadrosaurier, Löwe und Gnu oder Fuchs und Hase. Der Mensch in der Steinzeit war vorerst noch in der Beobachterrolle und schlug sich als Sammler von Pflanzen und später dann zusätzlich als Mitesser an Kadavern toter Tiere durchs Leben.
Wegen seines wenig ausgeprägten Seh-, Hör- und Geruchssinns war er bei der Verfolgung von Tieren meist nur zweiter Sieger. So lernte Homo sapiens, sich den Gebrauch von Werkzeugen für die Jagd zu eigen zu machen. Das waren am Anfang veränderte Stein-, Holz- oder Knochenstücke, die er als Werkzeug oder Waffe einsetzte.
 Die ersten Steinzeitjäger haben ihre Jagden und Beutetiere mit Höhlenzeichnungen verewigt.
Die ersten Steinzeitjäger haben ihre Jagden und Beutetiere mit Höhlenzeichnungen verewigt.
Das Streben nach immer besserem Jagdwerkzeug zeichnete den Menschen jedoch aus, denn sonst wären es nur Hilfsmittel geblieben; und die benutzen auch Tiere, wie etwa Rabenvögel Steine beim Knacken von harten Früchten.
Jagen war nach dem Sammeln der nächste Evolutionsschritt des Menschen und steht damit noch vor dem Zeitalter des Sesshaftwerdens mit Ackerbau, Vieh- und Pflanzenzucht. Die San im südlichen Afrika sind heute noch eines der letzten indigenen Jäger- und Sammlervölker und leben seit Jahrtausenden von der Jagd sowie dem Sammeln von Pflanzen, Nüssen, Wurzeln und Beeren.

Der Jäger wird zum Gejagten – Ansitz auf Mr. Spots in Namibia.
Betrachtet man Raubtier und Mensch beim Jagen, so fällt auf, dass z.B. eine Großkatze wie der Leopard auch eine führende Impala-Antilope schlägt oder der Wolf dem noch lebenden Stück von hinten die Dünnungen rausreißt, während der Mensch so etwas nicht macht. Aber ist er deshalb ein besserer Jäger? Oder bildete sich aus dem Vermögen, sein eigenes Tun reflektieren zu können, ein Werte-Korsett und damit eine (Jagd)kultur heraus? Mit einem festen Regelwerk und Vorschriften, dass man unter anderem keine führenden Muttertiere in der Aufzuchtzeit erlegt oder ein Tier möglichst schnell und schmerzlos tötet.
Dabei gab es in den zwei Jahrtausenden bis Ende des 18. Jahrhunderts viele moralisierende Schriftsteller, die sich mit der Jagd auseinandersetzen. Die einen hoben positive Eigenschaften wie Disziplin, Charakterbildung, überlegtes Handeln und eine gewisse Härte gegen Unbilden des Wetters heraus, während andere sie als roh abtaten oder in Übermaßen betrieben, sie auch zum Nachteil der Menschen wirke.

In Jagdschlössern zeigt sich, dass der Adel aus dem Vollen geschöpft hat.
Dass es solche Auswüchse etwa in den eingestellten Jagen des Adels gab, verdeutlichen alte Gemälde und Stiche. Frühe jagdliche Standardwerke fassten daher nicht nur praktisches Jägerwissen zusammen, sondern brachten darüber hinaus zu Papier, wie sich ein waidgerechter Jäger in der Natur bewegt und was der Begriff mit sich bringt: Waidgerecht nennt man alles, was streng den Regeln, Sitten und Bräuchen des Waidwerks entspricht. So etwas kennen indigene Naturvölker nicht, da übermitteln die Alten vor allem ihr jagdpraktisches Wissen an die nächste Jägergeneration. Aber natürlich bringen auch sie in irgendeiner Form ein Opfer und danken dafür, dass man Jagderfolg hatte und so die Sippe ernähren kann.
Doch nach Jahrtausenden der Genese ist heute eines offensichtlicher denn je: Die Jagd dient in den Industrieländern schon lange nicht mehr ausschließlich der Nahrungsbeschaffung. Jäger regulieren in ihrer freien Zeit die Wildbestände in einer vom Menschen geprägten Kulturlandschaft auf gesunde Bestands- oder Besatzdichten und ein dem Lebensraum angepasstes Maß, während dort nur noch Berufsjäger und Förster dienstlich jagen und Beute machen.

Der Einsatz der Technik kennt keine Grenzen und hat die Nacht zum Tag gemacht.
Oder die Jagd ist zu einem Geschäftsmodell geworden, bei dem die einen ein Revier haben und Wildbestände hegen und andere die Teilnahme an Jagden sowie Abschussentgelte für Trophäenträger bezahlen. Nur die indigenen Einwohner Kanadas, Namibias, im ewigen Eis, Borneos oder anderswo auf der Welt jagen heute noch aus Tradition und um ihr Überleben mit Wildbret zu sichern.
Da sich das Kräftemessen zwischen Mensch und Tier über die Jahrtausende immer deutlicher zu unseren Gunsten verschoben hat, fragt sich manch kritischer Geist in den eigenen Reihen schon, ob das noch Jagd im eigentlichen Sinne ist? Und schießt dann nur noch über die offene Visierung, jagt mit Pfeil und Bogen oder geht sogar lieber fotografieren...

Man tötet, was man liebt
Jagd ist eine Herzensangelegenheit, und dennoch verstehen viele nicht, wie man das, was man liebt und einem anvertraut ist, töten kann. Zu hohe Wildbestände sind nicht gesund; innerartliche Konkurrenz mit körperlich schwachen Stücken, aufkeimende Tierseuchen und fehlende Beutegreifer sind das eine. Das andere Schäden in Feld und Wald. Jagdkritiker behaupten gerne, dass sich in der Natur alles selbst regelt. Das trifft für große Wildnisgebiete etwa im Norden Europas, in Nordamerika, Kanada, Alaska oder in Argentinien, Kasachstan, in der Mongolei und in den russischen Weiten zu. Ganz sicher aber nicht für eine vom Menschen geprägte Kulturlandschaft wie es z.B. Deutschland mit 232 Menschen pro km² ist. Da gibt es immer Gewinner und Verlierer. Manche Tierarten passen sich an und leben „mit“ dem Menschen (Fuchs, Schwarzwild usw.), andere würden über kurz oder lang verschwinden. Daher muss der Mensch regulierend eingreifen.
Bemerkenswert ist, dass Jäger dies in ihrer Freizeit tun und alles von ihrem versteuertem Einkommen bezahlen. Rufe nach dem Verbot der Jagd werden dennoch laut. Hochrechnungen zufolge würde es den deutschen Staat Milliarden kosten, wenn er diese Aufgabe selbst übernähme. Im Schweizer Kanton Genf hatte man genau das umgesetzt: Ein Wildhüter im Genfer Wildmanagement-System kostete den Steuerzahler im Jahr 2014 etwa 98.200 Euro jährlich, das machte bei zwölf Stellen rund 1,2 Millionen Euro. Ganz schön teuer, um 500 Wildschweine zu erlegen. Bezogen auf Deutschland wären das fast fünf Milliarden Euro für die staatliche Wildschadens- und Seuchenprävention bzw. den Artenschutz, denn hier werden jährlich etwa zwei Millionen Rehe, Wildschweine und Hirsche erlegt. Zudem gehen dem Kanton Genf Einnahmen verloren, bis 1974 zahlten rund 400 Jäger umgerechnet insgesamt 262.000 Euro für Jagdpatente.

Er ist wieder da!
Der Wolf ist in vielen europäischen Ländern in seinem Bestand längst nicht mehr gefährdet. Sein günstiger Erhaltungszustand wird in den nächsten Jahren sicher weitere Veränderungen mit sich bringen; selbst eine reguläre Schusszeit könnte in Gebieten mit besonders hoher Wolfsdichte wieder Realität werden. Die Schweden bejagen den Wolf bereits nachhaltig und versuchen jedes Jahr wenigstens den Zuwachs abzuschöpfen. In Nordamerika, Kanada, Alaska oder Russland ist Wolfsjagd die natürlichste Sache der Welt.
Nur in Deutschland haben sich Naturschutzverbände wie der NABU den Wolf als lukratives Kampagnentier gekrallt und verdienen viel Geld mit ihm. In Deutschland gibt es allerdings seit Mai 2025 eine Debatte über die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht, um einen leichteren Abschuss zu ermöglichen. Angestoßen wurde dies durch einen Beschluss des EU-Parlaments zur Senkung des Schutzstatus des Wolfs.
Klar finden die meisten Stadtmenschen den Wolf faszinierend, auch wenn sie wahrscheinlich nie einen freilebenden Wolf zu Gesicht bekommen werden. Die Probleme ausbaden müssen die Menschen auf dem Land wie etwa Landwirte, Pferdehalter und Schäfer. Gerissene Nutztiere werden pro Landwirt zwar bis zu einer gedeckelten Obergrenze und bei Einhaltung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen entschädigt, aber der gesellschaftliche Ruf nach Tierwohl mit Freilandhaltung und das Tierleid nach einem Wolfsangriff passen irgendwie nicht zusammen.
Darüber hinaus kann es einen Naturliebhaber nicht kalt lassen, dass der Wolf sich seinen Lebensraum frei aussuchen darf, während das Rotwild z.B. in Bayern auf 14 Prozent und in Baden-Württemberg sogar auf nur vier Prozent der Landesfläche geduldet wird. Außerhalb dieser Rotwildbezirke soll bzw. muss es erlegt werden. Dieser Zwei-Klassen-Tierschutz ist ein Armutszeugnis!

Text: F. und S. Numßen
Bilder: Geranimo - unsplash, Vitor Paladini - unsplash, Simone Jo Moore - unsplash, Julien Riedel - unsplash, FN, SN